Will niemand gute Nachrichten?
- Ronald Keusch
- 4. Mai 2025
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 20. Mai 2025
Über das Buch „33 erstaunliche Lichtblicke - warum unsere Welt besser ist als wir denken“ von Axel Bojanowski

„Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner“, so lautete die Überschrift eines bekannten Gedichts von Erich Kästner, in dem der Schriftsteller und prominente Kritiker der Zustände in der Weimarer Republik seiner Leserschaft auf diese rhetorische Frage unter anderem antwortet: „Ihr streut euch Zucker über die Schmerzen und denkt, unter Zucker verschwänden sie.“ Und tatsächlich, wenn man die Zustände im heutigen Deutschland mit denen vor knapp 100 Jahren vergleicht, dann ist dieses Gedicht mit seiner schonungslosen gesellschaftskritischen und antimilitaristischen Haltung bestürzend aktuell: „Ein Friedhof ist kein Lunapark.“
Angesichts des im Mai 2025 im Westend-Verlag erschienenen Buches des namhaften Wissenschaftsjournalisten Axel Bojanowski musste ich unwillkürlich an diese legendär gewordene Aufforderung an den Dichter Kästner denken. Allerdings unter entgegengesetztem Vorzeichen. Denn der Titel des aktuellen Buches von Bojanowski verspricht „33 erstaunliche Lichtblicke - warum unsere Welt besser ist als wir denken.“
Der Autor wäre kein renommierter Vertreter der Wissenschaft, wenn er die erkannten existierenden globalen Missstände und Probleme nicht sehen und benennen würde. Und er stellt suggestiv die Frage, ob denn die Welt ein solch guter Ort ist, wo überhaupt in Anbetracht der unvorstellbar großen Fortschritte noch Kritik zu üben ist. Seine Antwort ist ein Zitat des Datenforschers Max Roser von der Internet-Plattform „Our World in Data“, von der auch die meisten Grafiken in diesem Buch stammen. Der international bekannte Forscher Roser hat die Lage exzellent auf den Punkt gebracht: „Die Welt ist schrecklich. Die Welt ist viel besser. Die Welt kann viel besser sein. Alle drei Aussagen gelten zugleich“. Wer allerdings sich allzu oft und nicht selten ausführlich auf die erste Aussage konzentriert, der ignoriert die Wirklichkeit. Ein Resümee in der Buchankündigung des Westend-Verlages lautet deshalb: „Naiver Optimismus lähmt ebenso wie naiver Pessimismus. Weiterer Fortschritt ist notwendig – die Welt kann noch viel besser sein.“
Um die Frage zu beantworten, ob die Welt besser ist als wir denken, begibt sich der Autor an einem tristen Wintertag mit Minusgraden zunächst 200 Jahre in die Vergangenheit. Kalte Wintertage dämpften nicht einfach die Laune, sondern waren damals für viele Menschen lebensbedrohend. Noch zu Goethes Zeiten konnte die Tinte gefrieren, wer an Holz und Kohle sparen musste, der fror. Wer denkt heute noch daran, wenn er Wasser aus der Leitung zapft, dass man zu früheren Zeiten in Eimern Wasser aus Brunnen nach Hause schleppen musste. Der Fortschritt an Hygiene und moderner Medizin ist revolutionär. Noch zu Goethes Zeiten starben zwei von fünf Kindern, der Verlust war auch für Wohlhabende schreckliche Normalität. Ein 10jähriges Kind erlebt heute mit größerer Wahrscheinlichkeit das Rentenalter als seine Vorfahren ihren fünften Geburtstag. Der Autor führt uns mit vielen Beispielen vor Augen, dass der Aufschwung der vergangenen 200 Jahre atemberaubend ist und sich alle Lebensbereiche massiv verbessert haben (S.12-14).
Am Beginn der Auflistung der angekündigten 33 Lichtblicke will der Journalist seine Leser in recht origineller Weise daran erinnern, dass die große Mehrzahl nur sehr vage oder falsche Vorstellungen auch über unsere Zeit besitzt. Dazu zitiert er den schwedischen Arzt und Wissenschaftler Hans Rosling, der vor zehn Jahren Politikern und Journalisten insgesamt neun Fragen zum Zustand der Welt stellte, zum Beispiel Fragen zum Einkommen und zur Arbeit auf der Erde, zur Lebenserwartung, zur Verbreitung von Kinder-Impfungen oder zu Opferzahlen von Naturkatastrophen. Statt vier Antworten wie beim Jauch-Millionärs-Quiz wurden drei Antwortvarianten vorgegeben.
Zur Frage, wie sich die Anzahl der Todesfälle durch Naturkatastrophen in den vergangenen hundert Jahren verändert hat, waren die möglichen Antworten: mehr als verdoppelt, ungefähr gleichgeblieben oder mehr als halbiert. Die korrekte Antwort: Die jährlichen Todesfälle durch Naturkatastrophen sind in diesem Zeitraum um mindestens 75 Prozent zurückgegangen, obwohl sich die Weltbevölkerung mehr als vervierfacht hat, die Zahl hat sich also mehr als halbiert. Die meisten rieten bei dieser und den anderen Fragen „so falsch, dass ein Schimpanse, der zufällig Antworten auswählt, die Befragten übertrumpft hätte“, so stellte Rosling fest. Und deshalb formuliert der Autor Bojanowski seine erste Zwischenüberschrift so: „Neun Fragen, die Schimpansen besser beantworten als Politiker“ und merkt als erste Zwischeneinschätzung dazu an, dass die Welt trotz aller Unvollkommenheit, in einem erheblich besseren Zustand ist, als viele denken (S. 15ff.).
Schon so hinreichend gewarnt, kann die Mehrzahl der Leser nun in den folgenden Abschnitten konstatieren, dass für sie viele Zahlen, Fakten und Zusammenhänge bisher unbekannt waren. Extreme Armut war in der Vergangenheit weltweit normal. Erst die Wirtschaftsentwicklung mit dem Beginn der Industrialisierung ermöglichte es den Menschen, Armut hinter sich zu lassen. Vor 200 Jahren waren 90 Prozent der Menschheit Analphabeten. Heute können 90 Prozent der Menschen lesen. Die Bildung ist der entscheidende Schlüssel zum Wohlstand (S. 25). Der Hunger auf der Welt wurde zurückgedrängt. Und trotz wachsender Weltbevölkerung haben immer mehr Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser, obwohl sich die Sorge um die weltweite Versorgung mit Trinkwasser und seine Verfügbarkeit vergrößert hat. Das alles ist belegt durch internationale Studien und Analysen, aufbereitet in den Grafiken und Tabellen (S. 41ff.).
Der Autor bleibt nicht im Dickicht von eindrucksvollen Zahlen und Tabellen stecken, sondern präsentiert den Alltag der Menschen wie im Kapitel „Der Zauber der Waschmaschine“, wo er die Eindrücke einer Oma schildert, die jahrzehntelang für ihre vielköpfige Familie alle Wäsche mit der Hand erledigen musste. Nunmehr setzte sie mit Knopfdruck das automatische Waschen in Gang (S. 57ff.). Das kann Romantiker und Schwärmer von der „guten alten Zeit“ schon auf den Boden der Realität bringen.
Ein großer Themen-Komplex widmet sich den immensen Fortschritten in der Medizin (S. 60ff.), der Erfolgsgeschichte der intensiv getesteten und sehr wirksamen Impfungen und schließlich dem „Wunder des immer längeren Lebens“, so die Überschrift eines Kapitels. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrug die Lebenserwartung eines Neugeborenen im weltweiten Durchschnitt nur 32 Jahre. Mittlerweile hat sich der Wert auf 72 Jahre mehr als verdoppelt (S.81).
Während diese bisher ausgeführten Fakten noch politischen Konsens finden könnten, bieten spätestens dann die Lichtblicke zu Wetter und Klima jede Menge an Wahrheiten mit Sprengstoff in der politischen Diskussion. Sie sind wohl deshalb in der Mitte Buches ein wenig versteckt und gut gelagert. Oder wie will man das von Wissenschaftlern mit Luft- und Satellitenbildern erforschte überraschende Phänomen bezeichnen, dass Inseln in der Südsee oder auf den Malediven wachsen – trotz Meeresspiegelanstieg und außerdem sogar die dortigen Atolle mit dem Meer mitwachsen. Wo doch beispielsweise die Parteivorstände der deutschen Grünen regelmäßig mit Steuergeldern auf Dienstreisen mit ihrem fachideologischen Blick feststellen, dass die Inseln im fernen Polynesien seit Jahren untergehen. Die Forscher stellen die Probleme des Meeresanstiegs nicht in Abrede, zeigen gleichzeitig aber die reale Situation und Lösungen (S. 102ff.).
Als eine der größten Erfolgsgeschichten bezeichnet der Autor den Schutz vor Wettergefahren. Trotz der seit Beginn des 20. Jahrhunderts vervierfachten Weltbevölkerung und zunehmender globaler Erwärmung ist die Wahrscheinlichkeit, wegen einer Wetterkatastrophe zu sterben, um mehr als 95 Prozent gesunken (S.106): „Nie war die Welt sicherer vor Wetterextremen“. Allerdings wird der Klimawandel die Wetterrisiken verschärfen und birgt langfristig Risiken. Grafiken zeigen den realen Rückgang von Wetterkatastrophen, dennoch wird die öffentliche Meinung von Klimahysterikern dominiert. Mehr noch, die Forscher beklagen: „Wir bekommen Hass-Mails, weil unsere Daten nicht zeigen, dass Katastrophen zunehmen… Niemand will gute Nachrichten“ (S. 110).
In weiteren Kapiteln ist nachzulesen, wie sehr sich die Wettervorhersagen verbessert haben, auch durch die Nutzung von Satelliten, die inzwischen kilometergenaue Datenpunkte liefern, und durch Supercomputer, die präzise Prognosen liefern. Eine Vier-Tages-Wetter-Prognose fällt heute so aus, wie vor 30 Jahren eine Ein-Tages-Prognose. Um so bitterer, wenn Warnungen der Meteorologen wie bei der Ahrtal-Katastrophe 2021 ignoriert werden. Dazu werden ergänzend Fragen der Umwelt behandelt. So lautet eine für manchen Zeitgenossen provokante Überschrift zum Naturschutz: „Wirtschaftswachstum macht die Umwelt sauber“. Zerstört die Menschheit die Natur? So fragt der Autor und antwortet ausführlich mit Daten und Fakten, die Hoffnung machen. Naturschutzgebiete haben heute eine Rekordgröße erreicht, knapp ein Sechstel der Landoberfläche der Erde und sieben Prozent der Ozeane sind geschützt. Die Waldflächen der Erde wachsen, Wirtschaftswachstum sorgt für saubere Luft und sauberes Wasser (S. 124).
Zu den aufgelisteten Lichtblicken zählt auch die Abwendung einer der größten durch die Menschheit verursachten Umweltkatastrophen. Mit dem Einsatz von FCKW wurde die Ozonschicht zunehmend zerstört und es entstand das Phänomen des Ozonlochs. Unter der Führung der Vereinten Nationen kam 1987 das Montrealer Protokoll zustande, das die Herstellung und Verwendung von FCKW und anderer Gase regulierte. In der Folge sank die Schadstoff-Emission um mehr als 99 Prozent – und tatsächlich zeigen Messungen, dass die Ozonschicht sich zu erholen beginnt, die Maßnahmen scheinen zu wirken. Was als eine der größten von Menschen verursachten Umweltkatastrophen begann, wurde zu einer der größten Erfolgsgeschichten der Menschheit (S. 147ff.).
Biber-Schäden am Ufer der Dahme in den Müggelbergen Foto: Ronald Keusch
Autor Bojanowski wendet sich in den folgenden Kapiteln seines Buches auch den Fischbeständen in den Weltmeeren und dem Artenschutz von Wildtieren zu. Der Biber, einst gejagt wegen seines Pelzes und nahezu ausgerottet, habe sich fast ganz Europa zurückerobert und dank Schutzprogrammen und Auswilderungen seit 1960 um mehr als 16.000 Prozent (!) vermehrt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren nur noch ein paar Tausend Biber in Europa übrig, mittlerweile sind es wieder mehr als 1,2 Millionen (S.158). In Deutschland gehen aktuelle Zahlen inzwischen von einer Population von 40.000 Tieren aus. Wie sich solche ungezügelten Formen des Tierschutzes entwickeln, zeigt beispielsweise ein Spaziergang am Uferstreifen vom Langen See und der Dahme in Berlin. Hier haben Biberfamilien die traditionelle Kulturlandschaft des Waldes der Müggelberge in ein Trümmerfeld verwandelt und unzählige Bäume am Uferweg in den See gekippt. Zu den „Problemwölfen“ haben sich in Deutschland die „Problembiber“ gesellt, die in Siedlungen vordringen, Schäden an Kläranlagen, Deichen, Wasserrückhaltebecken und Fischteichen anrichten. Jeder kann sich die Schattenseiten von grenzenlosem Artenschutz zum Schaden der Natur ansehen.
Am Schluss seines Diskurses lässt es sich der Wissenschaftsjournalist Bojanowski nicht nehmen, in einem extra Kapitel noch ausführlich auf die „ewige Quengelei der Fortschrittsskeptiker“ einzugehen. Und er zitiert genussvoll die New York Times vom 9. Oktober 1903 mit der Prophezeiung: „Eine bis zehn Millionen Jahre würde es noch dauern, bis es bemannte Flugzeuge gebe“. Nur neun Wochen später gelang den Gebrüdern Wilbur und Orville Wright der erste bemannte Flug (S.175). Um dann mit seiner Erkenntnis fortzusetzen: „Die Menschheitsgeschichte ist ein Kampf gegen Fortschrittsskepsis.“
Auch Unfälle nähren die Skepsis. Dazu zählt der Untergang der angeblich unsinkbaren Titanic, Symbol für die Hybris der Menschheit, wie auch der Einsatz von Atombomben und die Havarie des Kernkraftwerkes Tschernobyl als Warnung vor der Atomkraft. Doch trotz aller Unkenrufe, so Bojanowski, die Schiffe und die Atomkraftwerke wurden sicherer. Und er kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Bildungspolitik. Von den Vorzügen des Fortschritts ist im Schulunterricht in Deutschland kaum mehr die Rede, Öko-Dystopien bestimmen den Lehrplan, Nichtregierungsorganisationen (NGO) gelten als seriöse Quelle für Unterrichtsmaterial, „Ausbeutung wird angeprangert, ausgeklammert bleibt, dass Wachstum und Fortschritt jeden Tag Zehntausende aus extremer Armut befreien. … Und während in Europa Jugendliche gegen fossile Energie demonstrieren, hängt die Ernährung von fast der Hälfte der Menschheit an fossilem Erdgas, mit dem über das Haber-Bosch-Verfahren Dünger hergestellt wird“ (S.178). Und so warnt der Autor: „Fortschrittsskeptiker argumentieren auf dünnem Eis.“
Das letzte der 33 Kapitel über die Lichtblicke ist überschrieben mit dem Titel „Optimismus – wer mehr weiß, ist zuversichtlicher“ (S. 181). In Deutschland untergräbt Umwelt-Katastrophismus den Glauben an den Fortschritt. Bojanowski befasst sich mit dem Phänomen, warum die Mehrheit der Menschen in den westlichen Staaten glaubt, „dass Armut weltweit zugenommen habe und es der Umwelt immer schlechter geht, obwohl beides falsch ist.“ Umfragen zeigen: Pessimismus ist an mangelnde Bildung gekoppelt. Gut informierte blicken optimistischer in die Zukunft.
Und schließlich werden als Epilog zehn Tipps als Rüstzeug gegen die Apokalyptik geliefert. Sie basieren auf den Empfehlungen des Wissenschaftlers Hans Rosling, der dadurch berühmt geworden war, Naturkatastrophen in Afrika mit raffinierten Methoden einzudämmen. Mit dem Ziel - „Wir müssen den Leuten Angst machen!“ – bat US-Vizepräsident Al Gore im Jahr 2009 Rosling um Hilfe beim Kampf gegen den Klimawandel. Rosling lehnte das Angebot ab. Beide stimmten zwar darin überein, dass Handeln notwendig ist, aber Roslings Credo ist: Angst sorgt „für dumme Entscheidungen mit unvorhersehbaren Nebenwirkungen“ (S. 187). Und so entwickelte er in seinem Buch „Factfulness“ Handlungsempfehlungen, wie man Risiken und Probleme realistischer einschätzen kann.
Es gibt die schöne Redewendung von den Büchern, die in keinem Haushalt fehlen sollten. Zu diesen gehört unbedingt Bojanowskis Buch von den 33 Lichtblicken. Das Leitmotto vieler Politiker und Medien besteht heute darin, Angst zu verbreiten – Angst vor dem Klimawandel, möglichen Pandemien, neuen Technologien oder dem Wachstum. All diesen Katastrophen-Propagandisten und Klimahysterikern setzt das Buch einfach Fakten und naturwissenschaftliche Erkenntnisse entgegen und liefert damit einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung.
Axel Bojanowski, 33 erstaunliche Lichtblicke – Warum die Welt besser ist, als wir denken
Westend-Verlag; 192 Seiten; Erscheinungstermin 5. Mai 2025







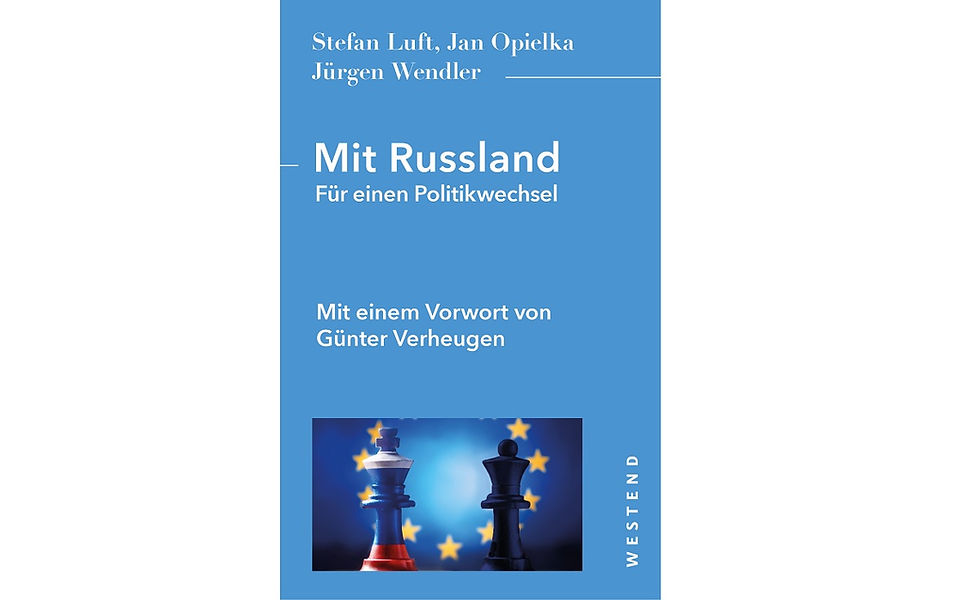
Kommentare