Nie wieder Krieg
- Ronald Keusch
- 13. Nov. 2025
- 6 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 14. Nov. 2025
Über das Buch „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“ von Albrecht Müller aus dem Westend Verlag

Eigentlich hatte sich Albrecht Müller geschworen, kein Buch mehr zu schreiben. Und dennoch entschließt er sich im Alter von 86 Jahren, seine biografischen Notizen zu veröffentlichen. Und der Grund, den Albrecht Müller nennt, ist so nachvollziehbar wie auch erschreckend: „Weil mir immer wieder Menschen bzw. deren Texte in den Medien begegnen, die vom Krieg reden, als sei dies eine harmlose Sache, als sei Krieg die mögliche Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. So ist es nicht. Kriege sind fürchterlich. Nie wieder Krieg – das ist der konsequente Schluss aus den Kriegserfahrungen“ (S.7).
Am 2. November ist nun dieses Buch im Westend Verlag erschienen und trägt schon in seinem Titel eine zentrale Botschaft an seine Leser: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“. Und die Unterzeile des Buchtitels sagt dem Leser, was er auf den 160 Seiten erwarten kann, keine Pamphlete und Losungen, sondern, wie es Albrecht Müller formuliert - „Meine Notizen und Lehren aus einem langen Leben.“
Der historisch gut informierte Leser wird die Herkunft dieses schlichten Bekenntnisses „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“ zuordnen können. Es ist ein Schlüsselsatz, den Willy Brandt als Parole in seiner Regierungserklärung am 28. Oktober 1969 und in seiner Friedensnobelpreisrede am 11. Dezember 1971 in Oslo formulierte. Dieser Satz ist auch Albrecht Müllers großes Credo und ist die Klammer zwischen den beiden Kapiteln des Buches – dem ersten Kapitel, in dem der Autor eine Fülle von Argumenten für Friedenspolitik auflistet und dem zweiten Kapitel, das stark biographisch geprägt ist. Hier berichtet Müller von seinen politischen Stationen als Wahlkampfleiter für Willy Brandt und Mitgestalter der Ostpolitik und zieht Lehren aus Jahrzehnten öffentlicher Verantwortung, persönlich, streitbar und nachdenklich – etwas, was der heutigen Führungsspitze der SPD scheinbar abhandengekommen ist.
Das erste Kapitel des Buches ist mit „Nie wieder Krieg“ überschrieben. Besonders emotional ergreifend sind hier die Schilderungen des Autors, wie er als kleiner Junge die Schrecken des Krieges in seinem Heimatdorf erlebte, gelegen zwischen Mannheim, Heilbronn, Bruchsal, Pforzheim und Würzburg. Da sah er den feuerroten Himmel über allen diesen brennenden Städten. Und sie brannten mehrmals nach Bombenangriffen der britischen und US-amerikanischen Luftwaffe. „Und dann kam das ganze Elend der Ausgebombten und der Flüchtlinge, der Kriegerwitwen, der Kriegswaisen und der Kriegsheimkehrer: Anti-Kriegs-Lehrmaterial am laufenden Band“ (S.14). Und der Autor listet die Zahlen zerstörter Städte auf und muss feststellen, dass nach dem Anteil zerstörten Wohnraumes die am härtesten getroffene Städte nicht Dresden, Hamburg und Berlin waren, sondern Düren (99 Prozent), Wesel (97 Prozent) und Paderborn (85 Prozent). Albrecht Müller ermuntert seine Leser, am besten selbst für Ihre Heimatstadt und Region aufzurufen, was es an Informationen im Netz dazu gibt. Und so hier sein Resümee: „Auch wenn man nur einen kleinen Ausschnitt des Leids, der Schmerzen und des Todes im Blick hat, muss einem ein heute gefälliges Wort wie Kriegsertüchtigung im Halse steckenbleiben“ (S.21).
Weil Albrecht Müller den Zweiten Weltkrieg trotz Kindesalter noch wahrgenommen hat, kann er nicht begreifen, „wie ein in Verantwortung stehender Politiker wie der deutsche Verteidigungsminister Pistorius am 29. Oktober 2023 davon sprechen kann, wir sollten kriegstüchtig werden. Das ist verantwortungsloses, unsensibles Geschwätz. Pistorius ist 1960 geboren, er hat also den Zweiten Weltkrieg selbst nicht erlebt. Aber man könnte eigentlich auch ohne eigenes Erleben und Erfahren wissen, was Krieg bedeutet“ (S.28).
Im historischen Rückblick wird die Kritik des SPD-Mannes Müller noch schärfer, wenn er auf das Berliner Grundsatzprogramm der SPD von 1989 eingeht, das nur anderthalb Monate nach dem Mauerfall in Berlin verabschiedet wurde. Viele wissen heute nicht mehr, wie weitblickend dieses Programm gerade in sicherheitspolitischen und außenpolitischen Fragen war. Hier nur einige der markanten Aussagen:
„Frieden in gemeinsamer Sicherheit“, oder
„Der Krieg darf kein Mittel der Politik sein“, oder
„Friedenspolitik umfasst auch Zusammenarbeit der Völker in Fragen der Ökonomie, Ökologie, Kultur und Menschenrechte“, oder
„Unser Ziel ist es, die Militärbündnisse durch eine europäische Friedensordnung abzulösen“.
Und resignierend Albrecht Müller: „Heute würden die Regierenden nicht einmal im Traum so etwas zu denken wagen.“ Heute habe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Anlass genug, sich dafür zu schämen, ihre eigenen Erkenntnisse und Willenserklärungen seit 1990 so außer Acht gelassen zu haben. „Verraten könnte man ohne bösen Willen und Übertreibung sagen“ (S.49-50).
Einen großen Platz räumt der Autor der Frage ein, wie es zum Abschied von der Vertrags- und Verständigungspolitik gegenüber Russland kommen konnte. Sein Fazit kann nur lauten, dass eine neue Entspannungspolitik dringend notwendig ist. Und er spitzt noch zu, diese Politik ist überlebensnotwendig. Für Albrecht Müller ist die Kriegsgefahr größer geworden und er zählt dazu neun Gründe für Gefahr und Risiken auf, die mehr als beunruhigen (S.72ff.).
Aber er schließt ein Kapitel an mit der Überschrift „Was ist zu tun?“ und nennt insgesamt 15 Punkte, die teilweise sehr praktisch angelegt sind (S.77ff.):
„Deutschland muss erklären, dass wir keine Feindschaft mit anderen Völkern und Ländern haben wollen“, oder
„Wir beenden die Sanktionen, … wir treten mit Russland wieder in die Handelsbeziehungen ein, wie sie in der Vergangenheit möglich waren“, oder
„Wir beziehen Gas und andere Rohstoffe auch aus Russland“, oder
„Wir rüsten ab. Wir ziehen das 200 Milliarden Programm zurück“.
Und schließlich als letzten Punkt: Es ist unbedingt notwendig, eine umwälzende Medienarbeit in Deutschland durchzusetzen mit einer Abkehr von Kriegslogik und Propagandakampagnen. Wobei Letzteres, so der Autor, nicht nur die westliche Welt betrifft, sondern auch Russland. Doch auf die Frage, wer die vielen anstehenden Aufgaben im Kapitel „Was ist zu tun“ wirklich tun soll und kann und will, darauf hat er keine Antwort.
So mutig die Kritik von Albrecht Müller an der heutigen Parteiführung der SPD ausfällt, die das Vermächtnis der Ostpolitik von Brandt und Bahr mit Füßen tritt, so fehlt wiederum der Mut, über Bündnispartner im BSW und der AfD nachzudenken, die im Konflikt mit Russland auf Verhandlungen und Diplomatie setzen. In der Frage Krieg-Frieden darf es keine Brandmauern geben!
Die Lebenserinnerungen von Albrecht Müller unter dem Titel „ …und andere Lehren aus einem langen Leben“ lesen sich dann streckenweise wie Geschichten von einem anderen Stern. Da wird erzählt wie Albrecht Müller, ausgebildet im Evangelischen Studienwerk, als Diplom-Volkswirt zum Spezialisten für Wahlkämpfe wird. Und dann kommt das Jahr 1972. Zur Absicherung der Friedens- und Reformpolitik Willy Brandts war Müller mit einem Team verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und den Wahlkampf der SPD. Und sie haben zum besten Wahl-Ergebnis der Sozialdemokratie in ihrer Geschichte beigetragen: 45,8 Prozent.
Interessante Fakten liefern die Abschnitte, in denen sich der Autor mit dem Erfolg der Wahlkampagne 1972 detailliert beschäftigte. Einer der Slogans damals hieß: „Deutsche - Wir können stolz sein auf unser Land“ (S.114). Und hier tauchte auch die Losung auf „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“. Diese Losungen wurden im August 1972 von dem Elsässer Grafiker Tomi Ungerer illustriert und damit die Wahl-Kampagne eingeläutet.
Hier wird auch die Geschichte um den Ursprung der Pleisweiler Gespräche erzählt. Das alte Gemäuer einer Wasserburg in der Region des Südpfalz wurde von Albrecht Müller zu einem Platz für Vorträge und Gesprächsrunden über die Parteigrenzen ausgebaut. Das Buch liefert eine Auswahl der Veranstaltungsthemen, beginnend im Jahr 1986.
Die Gründung der NachDenkSeiten - für viele ein Höhepunkt der politischen Aktivitäten von Albrecht Müller - wird erst am Schluss des Buches auf drei Seiten behandelt. Als das Internet eine neue Medientechnik zur Verfügung stellte, wurde eine Website entworfen, die im November 2003 an den Start ging – der Beginn der heutigen NachDenkSeiten. Mittlerweile hat sich die Leserschaft gewaltig erweitert und die Redaktion zählt insgesamt mehr als zehn Personen. Die NachDenkSeiten sind für Albrecht Müller „das Tüpfelchen auf dem i meines Lebens.“ Mit den namhaften engagierten Journalisten wie Chefredakteur Jens Berger, Tobias Riegel, Marcus Klöckner, dem offiziellen Vertreter des Redaktionsteams Florian Warweg in der Bundespressekonferenz sowie vielen hochkarätigen Autoren leisten die NachDenkSeiten einen wirklichen Beitrag zur Aufklärung der deutschen Öffentlichkeit. Der überwiegende Teil der Bevölkerung scheint die permanent auf sie niederprasselnde Kriegspropaganda nicht zu durchschauen.
„Die allgemeine Bevölkerung weiß nicht, was passiert, und sie weiß nicht einmal, dass sie es nicht weiß.“ (Noam Chomsky)
Um so dringlicher ist es, dieses Buch von Albrecht Müller weiterzuempfehlen und einem jedem zu seiner Meinungsbildung einen täglichen Blick auf die NachDenkSeiten nahezulegen.
Albrecht Müller: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“ - Meine Notizen und Lehren aus einem langen Leben
Westend Verlag, 160 Seiten, Erschienen am 2. November 2025



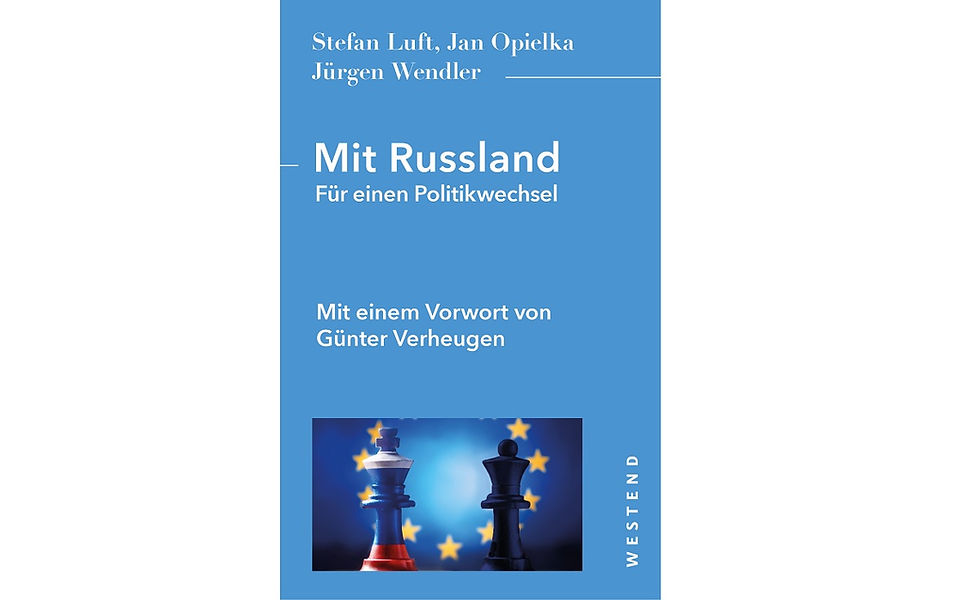
Kommentare